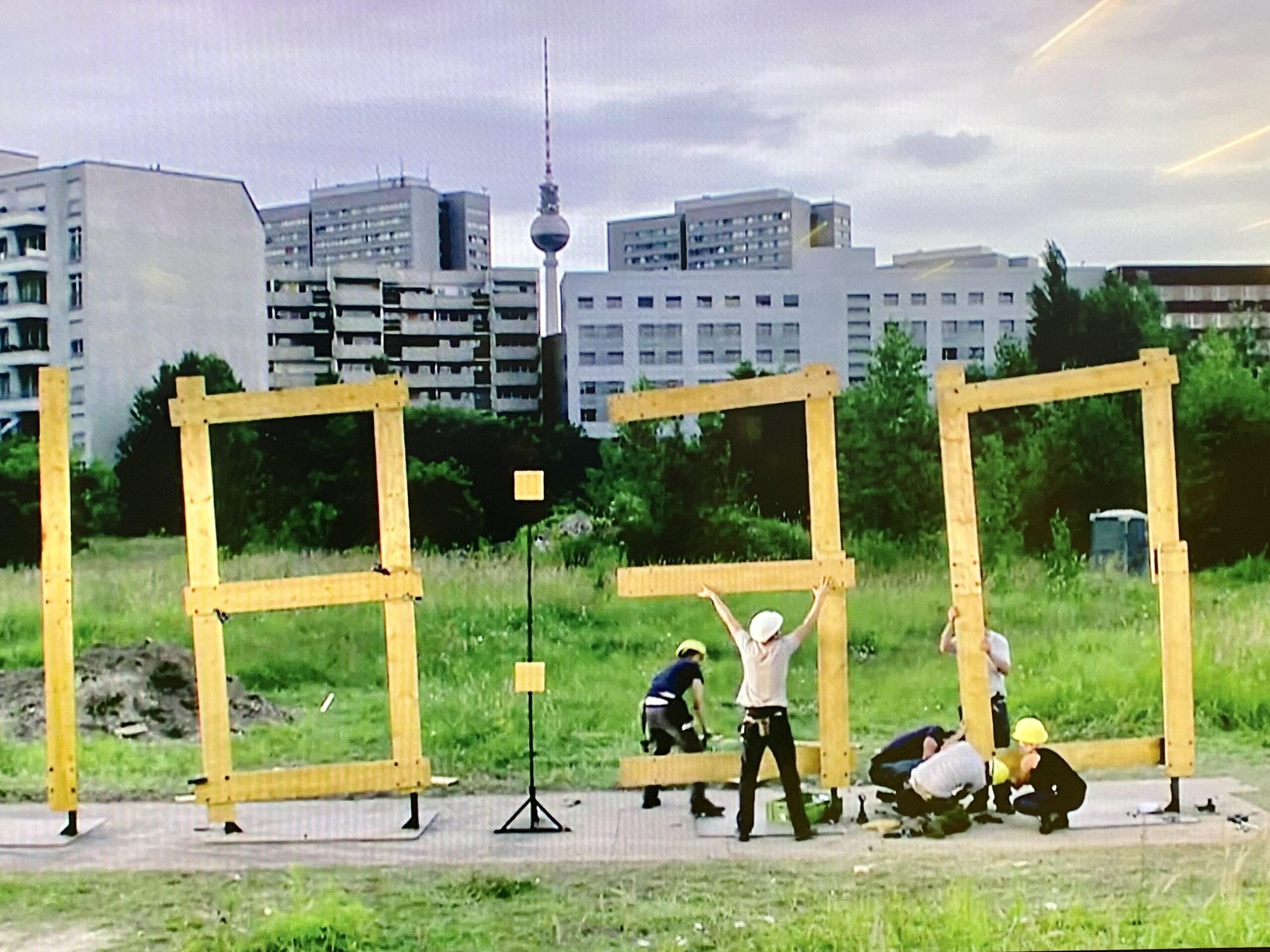 Agnès Varda nutzt in einem ihrer ersten Filme, einem Spielfilm (nicht, wie so oft, einem Dokumentarfilm), Cleo – Mittwoch zwischen 5 und 7, die 19. Stunde des Tages, genauer gesagt die letzte halbe Stunde der 19. Stunde des Tages, um das Porträt einer Frau, Cleo, oder wie man sie im Verlauf kennen lernen wird: Florence, zu zeichnen und dieses Porträt so zu vervollständigen, wie es nur durch eine Auslassung möglich ist. Eine Auslassung, die auf die zweite Hälfte der neunzehnten Stunde des Tages fällt.
Agnès Varda nutzt in einem ihrer ersten Filme, einem Spielfilm (nicht, wie so oft, einem Dokumentarfilm), Cleo – Mittwoch zwischen 5 und 7, die 19. Stunde des Tages, genauer gesagt die letzte halbe Stunde der 19. Stunde des Tages, um das Porträt einer Frau, Cleo, oder wie man sie im Verlauf kennen lernen wird: Florence, zu zeichnen und dieses Porträt so zu vervollständigen, wie es nur durch eine Auslassung möglich ist. Eine Auslassung, die auf die zweite Hälfte der neunzehnten Stunde des Tages fällt.
Cleo also, an einem Mittwoch zwischen 5 und 7. Der Film spielt am Tag des Sommerbeginns und somit am längsten Tag des Jahres. Und tatsächlich erscheint dieser Tag für Cleo gedehnt; gedehnt aber nicht durch die hoch stehende, frühsommerliche Sonne, sondern von Sorgen. Bereits seit zwei Tagen wartet Cleo auf die Testergebnisse einer Krebsvorsorge. Auf der Suche nach einer frühzeitigen Festlegung der noch nicht bekannt gegebenen Testergebnisse besucht Cleo eine Wahrsagerin. Hier erst mit dem Moment der Auslegung und damit Mystifizierung ihres Schicksals durch die Tarotkarten, die im Übrigen auch die einzig farbige Sequenz im ansonsten schwarz-weißen Film darstellen, setzt der Film ein und erzählt von da an eine Geschichte mit zwei entgegenlaufenden Strängen. Der erste Strang, die Tarotkarten als Signifikanten einer höheren Gewalt, das erste Glied in einer Aneinanderreihung abergläubischer Rituale und symbolischer Andeutungen. Der zweite Strang, Cleo im Spiegel[1], das Porträt einer jungen Frau. Ein Porträt, das Varda in Form von (Selbst)beobachtungen schreibt. Diese beiden entgegenlaufenden Stränge, die Potentialitäten und Zumutungen einer Rolle und das in der abergläubischen Schwebe gehaltene Schicksal werden gerahmt von der Gewissheit, die nur die Zeit bringen kann; genauer gesagt, die die Zeit bringt, und zwar um halb sieben. Bis dahin ist der Film unterteilt in 13 Unterkapitel (auch hier, 13, die Unglückszahl), die jeweils genau über den Zeitpunkt der Handlung Auskunft geben, aber eben nur bis halb sieben, anders als vom Titel angekündigt, Cleo – Mittwoch zwischen 5 und 7.
Doch wie verhalten sich Spiegel und Symbolik, das heißt Rolle und Schicksal auf der Kontrastfolie der ablaufenden Zeit? Welche Selbstverhältnisse bleiben übrig, scheint Cleo, trotziges Kind und kapriziöse Diva, doch schon auf eine Rolle hin festgelegt zu sein, und haben ihr die Tarotkarten schon ihr Schicksal bestätigt? Der Umgang mit ihr als Kind, eine Umgangsform, in der sie konstant in der »moral experience of being third [wo]man«[2] festgehalten wird, scheint nicht bloß eine Reaktion auf ihre momentanen Sorgen zu sein. Man wirft ihr vor, „es wäre ja immer irgendwas“. Die von Varda gewählte Metaphorik der Spiegel bestätigt diesen Eindruck. Cleos mal nervöse, mal stolze Blicke in den Spiegel stellen eine Referenz auf die frühkindliche Spiegelphase des Lacanschen L-Schemas dar[3]. Keine Minute auf den Straßen des Paris der 60er Jahre reflektiert Varda Cleos Porträt nicht in den Blicken der anderen und zeichnet es dadurch umso stärker. Doch die Blicke wandeln sich. Zunächst objektifizierend werden sie über den weiteren Verlauf des Films zu „sehenden“, das Schicksal materialisierenden Blicken, einer stetigen Aktualisierung der vielen weiteren düsteren Omen in Vardas mystischem Erzählstrang – ein neuer Hut, getragen an einem Dienstag, an diesem Mittwoch wandert die Sonne vom Sternzeichen der Zwillinge in den Krebs, Cleo kreuzt die Station Verlaine, benannt nach Paul Verlaine, einem französischen fin de siècle-Lyriker des Symbolismus, während eine Passantin vorahnend in die Kamera blickt.
Diese beiden parallelen Stränge – abergläubisch in Schach gehaltenes Schicksal und der Nachvollzug von Cleos Rolle – kreuzen sich an einem Moment. Von dort an erzählt der Film die Geschichte einer Emanzipation, die geradezu durch das Schicksalhafte und Irreversible der ausstehenden Krebsdiagnose bedingt zu sein scheint. Die Möglichkeit der Selbstvergewisserung verheddert sich in gleich zwei zerbrochenen Spiegeln, dem Element, das sonst immer Rückversicherung in den Blicken der anderen erlaubt. Das Zerbrechen der Spiegel, das zwar abergläubische Gewissheit über den Krebs verleiht, löst Cleo auch aus ihrer infantilen Spiegelphase. Wo bislang versucht wurde, die Unumgänglichkeit der Zeit und auch die mögliche Unumgänglichkeit der Krebsdiagnose – die Krebsdiagnose ist ja nur deshalb bedrohlich, weil Zeit nicht reversibel ist – über abergläubische Rituale und Tricks reversibel zu halten, können nun das Schicksal der Krebsdiagnose und Cleo nicht mehr getrennt gehalten werden. Hiergegen setzt der Moment von Cleos aktualisiertem Selbstverhältnis ein.
Kurz vor Ende des Films begegnet Cleo Antoine. Antoine ist nur für kurze Zeit in Paris, er ist als Soldat stationiert in Algerien, das zu diesem Zeitpunkt noch kolonial durch Frankreich besetzt wird – ein Umstand, der sich in diesen Tagen zu ändern beginnt. In den vorherigen Szenen hört man übers Radio, dass die französische Besetzung immer mehr ins Wanken gebracht wird. Über Antoine, der als Soldat im Krieg ebenso den Tod fürchten muss wie Cleo, wird die tatsächliche Welt fernab narzisstischer Selbstbespiegelung in Cleos Leben getragen[4]. Antoine und Cleo sprechen als Fremde und er sieht in ihr (hier kann der Film wohl keinen Kitsch entbehren) Renaissance, Italien, Botticelli, eine Rose – denn ihr eigentlicher Name ist Florence, nicht Cleo, wie Kleopatra, so erfährt man im Dialog. Im Gespräch zwischen Antoine und Cleo „enthüllt“ sich das eigentliche Thema des Films, das, wie mir scheint, eine Frage ans Erzählen, ans Porträtieren an sich ist.
Cleo und Antoine kommen auf das Thema der Nacktheit zu sprechen. Wir wissen bereits, dass Cleo die Nacktheit kritisch betrachtet. Als sie ihre Freundin Dorothée vom Modellstehen abholt, fragt sie sie, ob sie sich denn nicht genieren würde, wenn sie nackt vor so vielen Menschen steht. Sie, an Dorothées Stelle, würde befürchten, dass die anderen einen Fehler fänden. Die Freundin entgegnet, dass sei für sie absurd. Sie wäre glücklich über ihren Körper, nicht eitel. Die Nacktheit als Metapher erscheint dann weiter auch im Gespräch mit Antoine. Cleo behält ihren Standpunkt bei: Nacktheit, so findet sie, sei aufdringlich wie die Nacht und die Krankheit. Antoine findet, wenn man nackt ist, ist es einfach. »Liebe, Geburt, Wasser, Sonne, Strand, all das«. Genau in dem Moment erscheint das Bild zweier Krankenhausangestellter, die ein Frühgeborenes im Inkubator in ein Auto transportieren. Eine Mitfahrerin des Busses, in dem sich Antoine und Cleo beim Beobachten dieser Szene befinden, hält den Eindruck fest, der entsteht: ein Schneewittchen im Sarg. In dieser Allegorie, die gleich wieder von Antoine mit dem Kommentar entschärft wird, dass er schon einmal bei einer Geburt dabei gewesen sei, zeigt sich, dass Varda in Bezug auf die Nacktheit niemandem recht geben muss, weder Dorothée, Cleo noch Antoine.
Während Varda die ausstehende Diagnose über die ersten achtzig Minuten in Schach hält und mit der Emanzipationsgeschichte von Cleo als zweitem gegenläufigen Strang verwebt, kommen diese zwei Stränge kurz vorm Ablauf der Zeit, die der Film sich in seinem Titel auferlegt, zu einer Vereindeutigung. Um 18:30 erwischen Cleo und Antoine schlussendlich doch noch den behandelnden Arzt, der in seinem Cabrio die Anlagen des eindrucksvollen Pitié-Salpêtrère Hospitals verlässt. Eine spektakuläre Kulisse, die, wie Antoine und Cleo feststellen, eher nach höfischer Verausgabung in einem Ball als nach einem Krankenhaus ausschaut. Nüchtern, man könnte fast schon sagen, in Feierabendstimmung, bestätigt der Arzt die Krebsdiagnose. Wahrscheinlich sei nach zwei Monaten Behandlung alles wieder gut, man treffe sich ohnehin morgen um 11 zum Gespräch, da könne man alles weitere besprechen, sagt der Arzt und braust davon.
Eine halbe Stunde hätte der Film noch gehabt, um all das zu zeigen, was erwartbar gewesen wäre: ein Zusammenbruch, tröstende Worte, ein Kuss, Tränen. Er schließt allerdings mit zwei Sätzen von Cleo: »Il me semble que je n’ai plus peur. Il me semble que je suis heureuse«. Ihr scheint, sie hätte keine Angst mehr, ihr scheint, sie sei glücklich. Bei genauerem Hinsehen erkennt man genau eine Träne auf Antoines Wange. Das Filmplakat hatte den Zuschauer:innen noch eine halbe Stunde mehr versprochen. Varda verwehrt diese aber bewusst, ebenso wie Schlüsse auf die Beziehung zwischen Cleo und Antoine. Varda ist Dokumentarfotografin und auch wenn Susan Sontags viel zitierte Kamera-Pistolen-Analogie erst fünfzehn Jahre später erschienen ist[5], weiß Varda als eine der Webgereiterinnen des feministischen Films, was es bedeutet, ein Porträt mit einer Kamera zu zeichnen. Die letzte halbe Stunde ist die wirkmächtigste Metapher des Films. Während der Aberglaube sich bemüht, die Zeit in der Schwebe zu halten, und der Film sich in seinen 13 Kapiteln an die Realzeit hält, nimmt sich Varda für die letzte halbe Stunde die Freiheit der Regie, um die Zeit zu stoppen. Sie streicht die letzte halbe Stunde und zeichnet so einen Charakter nicht zu Ende, der sich gegen die Entblößung wehrt, und dem Varda dafür keine Gründe und keine Deutungsmuster überstülpen muss, außer eben die Spiegel als Anspielung auf ein Sich-selbst-gewahr-Werden. So gewährt Varda Cleo einen Freiraum, der für das Kino der 60er Jahre unwahrscheinlich ist.
[1] Parallel zu dem Spiegel spielt der Film auch noch mit dem Element der Maskerade. Cleo maskiert sich an mehreren Stellen, spielt mit Hüten in einem Laden und stellt fest, dass ihr alles steht. Anschließend fährt Cleo mit dem Taxi an einem Laden vorbei, der afrikanische Masken ausstellt. Die Bedeutung, die ihnen beigemessen werden kann, ist ambivalent. Während diese Masken auf der einen Seite auf die Dominanz der Fetischisierung in der französischen Gesellschaft der 60er Jahre gelesen werden können (vgl. Mouton, J. (2001). From Feminine Masquerade to Flâneuse: Agnès Varda’s Cléo in the City. Cinema Journal, 40(2), 3–16) bietet Ezra eine kritische Lesart der Masken, als fetischisierte und kommodifizierte »andere« Objekte an (vgl. Ezra, E. (2010). Cléo’s Masks: Regimes of Objectification in the French New Wave. Yale French Studies, 118/119, 177–190). Auch der eingeblendete Kurzfilm „Die Verliebten von Pont Mac Donald“ kann in seiner humoristischen Darstellung des „Schwarz-Sehens“ kritisch gelesen werden.
[2] Vgl. Goffman, E. (1961). Asylums. Anchor. Goffman schildert die „moral experience of being third man” im Kontext der Absprachen um scheinbar psychisch Kranke, in diesem Fall einer ständig infantilisierten Person, um über die in Bezug auf das Selbstverhältnis moralisch desintegrierte Erfahrung zu berichten, die aus Absprachen der Vertrauenspersonen hinter dem eigenen Rücken entsteht.
[3] Vgl. Zeric, A. (2019). Return to the Self: Agnès Varda’s Cleo from 5 to 7. Film Criticism, 43(3).
[4] O Dea, E. (2020): Cléo from 5 to 7 Review – A True Treasure of International Cinema, The Film Magazine [online].
[5] Sontag, S. (2005). In Platos Cave. In: On Photography. Rosetta Books. (EA 1977)








































