 Der gute alte Sonnenuntergang, den es als solchen seit Kopernikus ja leider auch gar nicht mehr geben darf, mag mancherorts noch als symbolisch-sinnliches Tagesende taugen (und als Vorwand für den ersten Alkohol des „Sundowners“), als Kriterium für ein klares, objektives, deutliches, also ein „wirkliches“ Ende ist er unbrauchbar. Da muß eine zumindest auf gemeinsame Zeitzonen eingenordete digital-präzise Punktualität her, ein „Schlag zwölf“, der gleich-zeitig ein „Schlag Null“ ist.[1] Die größte und reifste Stunde des Tages ist immer auch seine letzte, aber wie bei Menschen oft auch: der Tag stirbt „umnachtet“, der Schluß- ist kein Höhepunkt, kein „krönender Abschluß“, sondern ein ins dunkelste Dunkel gehüllter, meist verschlafener Zeitsprung, am Ende nicht mehr als ein winziger Zeigerruck, ein kurzes Klicken der Digitalanzeige, über das man getrost hinwegdämmern darf, um so mehr, als man die sofort anbrechende „Geisterstunde“ sowieso besser anderen, unglücklich wacheren Wesen überläßt. (Außerdem gilt ja seit langem auch schon: „one hour´s sleep before midnight is worth two after“. Und gerade gegen Mitternacht haben nur nostalgische Melancholiker, die gern von schmerzlich-süßen Erinnerungen geplagt werden, etwas vom Wachsein: „It begins to tell / ‚Round midnight / I do pretty well, till after sundown / Suppertime I’m feelin‘ sad / But it really gets bad / ‚Round midnight“[2]).
Der gute alte Sonnenuntergang, den es als solchen seit Kopernikus ja leider auch gar nicht mehr geben darf, mag mancherorts noch als symbolisch-sinnliches Tagesende taugen (und als Vorwand für den ersten Alkohol des „Sundowners“), als Kriterium für ein klares, objektives, deutliches, also ein „wirkliches“ Ende ist er unbrauchbar. Da muß eine zumindest auf gemeinsame Zeitzonen eingenordete digital-präzise Punktualität her, ein „Schlag zwölf“, der gleich-zeitig ein „Schlag Null“ ist.[1] Die größte und reifste Stunde des Tages ist immer auch seine letzte, aber wie bei Menschen oft auch: der Tag stirbt „umnachtet“, der Schluß- ist kein Höhepunkt, kein „krönender Abschluß“, sondern ein ins dunkelste Dunkel gehüllter, meist verschlafener Zeitsprung, am Ende nicht mehr als ein winziger Zeigerruck, ein kurzes Klicken der Digitalanzeige, über das man getrost hinwegdämmern darf, um so mehr, als man die sofort anbrechende „Geisterstunde“ sowieso besser anderen, unglücklich wacheren Wesen überläßt. (Außerdem gilt ja seit langem auch schon: „one hour´s sleep before midnight is worth two after“. Und gerade gegen Mitternacht haben nur nostalgische Melancholiker, die gern von schmerzlich-süßen Erinnerungen geplagt werden, etwas vom Wachsein: „It begins to tell / ‚Round midnight / I do pretty well, till after sundown / Suppertime I’m feelin‘ sad / But it really gets bad / ‚Round midnight“[2]).
Unmöglich allerdings, nicht wachzubleiben, wenn diese letzte 24. Stunde zur finalen Schlußstrecke einer Frist (stilisiert) wird, nach deren Ablaufen ein schreckliches Ende droht, weil ein Ultimatum abläuft, das nicht nur – wie etwa in der ersten Staffel der Serie „24“ (USA, 2001) – irgendwelche Terroristen gegen irgendwelche amerikanische Staatsorgane verhängt haben,
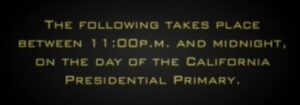
Echtzeitsimulation des Finales kurz vor 12: Vorspanntafel der 24. Folge der Serie „24“, 1. Staffel
sondern das ein Ultimum in einem Schreckens-Horror-Terror-Szenario für die ganze Welt und Menschheit darstellt. Metaphorisch will es dann die Torschlußpanik, daß es immer „Fünf vor zwölf“ ist, was ja lange die ikonische Uhrzeit für alle öko-apokalyptischen Endzeitwarnungen war: so hieß etwa 1992 eine kurzlebige wöchentliche Umweltschutz-TV-Reihe, die für kurze Zeit die im gleichen Jahr tragisch ums Leben gekommene frühe grüne Öko-Aktivistin Petra Kelly auf Sat1 (!) moderiert hatte ,
 (und die freilich nicht um 23.55 Uhr ausgestrahlt wurde: so spät wie im Titel angekündigt, durfte es für den Fernsehzuschauer natürlich nicht werden, denn der muß ja schließlich „morgen wieder raus“…) und so hieß 2007 der deutsche Verleih-Untertitel der Öko-Doku 11th Hour von Leila und Nadia Conners, der niemand weniger als Leonardo di Caprio himself als Moderator Reichweite und Glaubwürdigkeit verleihen sollte.[3])
(und die freilich nicht um 23.55 Uhr ausgestrahlt wurde: so spät wie im Titel angekündigt, durfte es für den Fernsehzuschauer natürlich nicht werden, denn der muß ja schließlich „morgen wieder raus“…) und so hieß 2007 der deutsche Verleih-Untertitel der Öko-Doku 11th Hour von Leila und Nadia Conners, der niemand weniger als Leonardo di Caprio himself als Moderator Reichweite und Glaubwürdigkeit verleihen sollte.[3])
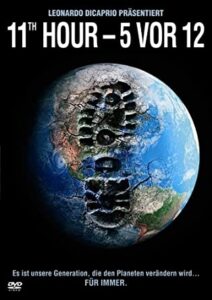
Für die Populär-Aufklärung genügen solche ungefähre Zeitmetaphern. Aber die unvermeidliche Verwissenschaftlichung und Professionalisierung auch der Endzeit-Prophezeiungen ermöglicht (und erfordert) höhere Ansprüche an die Exaktheit der Antwort auf die Frage nach der Zeit bis zum Weltende. Nicht einfach generisch-phrasenhaft „kurz vor zwölf“ ist es daher auf der „Doomsday Clock“, die seit 1947 vom amerikanischen „Bulletin of the Atomic Scientists“ der Öffentlichkeit medienwirksam präsentiert wird, sondern dort „ist es“ – jeweils ein Jahr lang – mal sieben Minuten (1947 und 1960), mal zwölf Minuten (1963 und 1973), mal 14 Minuten (1995) und auch mal nur zwei Minuten (2018 und 2019) vor Mitternacht. Aktuell reichen die beiden Zeiger zur präzisen Visualisierung gar nicht mehr aus, denn es ist (wie schon seit 2020) exakt 11:58:20 Uhr („it is still 100 seconds to midnight“). Die Zeiger werden nach Beratungen eines Science and Security Boards nach der Einschätzung der Weltlage in puncto Atomwaffen-Kontrolle, Entspannung und Klimarisiko feierlich neu gestellt; im für die Wissenschaftler weltgeschichtlich hoffnungsvollsten Moment, im Jahr 1991, war es dabei sogar schon mal ganze 17 Minuten vor zwölf. Erst die synoptische Aneinanderreihung dieser variierenden (oder konstanten) „Zeiten bis Mitternacht“ ergeben so etwas wie eine Geschichte der Hochrisikosensibilität der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.


Das unstete Hin- und Her der Apokalypsen-Uhr: Zeiten bis zum Weltuntergang, von 1947 bis heute (vgl. https://thebulletin.org/doomsday-clock/timeline/ und https://noticias.gospelmais.com.br/relogio-do-apocalipse-e-antecipado-por-cientistas-e-o-fim-do-mundo-fica-mais-proximo88099.html)
Wahrscheinlich ist es so unangemessen wie unvermeidbar, die pädagogische Hilflosigkeit zu belächeln, mit der hier das Undarstellbare darstellbar und das Unabsehbare absehbar gemacht werden soll, die verzweifelt um Anschaulichkeit bemühte Naivität, mit der hier der Abstand zum Abgrund, dem die Welt entgegentorkelt, genau zwischen zwei Uhrzeiger passen soll; so wie man auch über die inszenierte Seriösität spotten wird, mit der hier eine durch ein kleines „Drehen an der Uhr“ herbeigerufene Do-It-Yourself-Eschatologie propagiert wird („wer hat an der Uhr gedreht / ist es wirklich schon so spät?“ wurde einst bei „Paulchen Panther“ gefragt), um durch das in der Politikwissenschaft so genannte Verfahren der „Versicherheitlichung“ (securitization) öffentlichen Druck für bestimmte weltpolitisch durchzusetzende Handlungsoptionen aufzubauen.[4] Im Abgleich etwa mit den Überlegungen von Bruno Latour, der in seinem Hörstück Kosmokoloss, einer „Tragikomödie über das Klima und den Erdball“ von 2011, die Wissenschaftler Clive Hamilton (Requiem for a species, 2010) und James Lovelock (The Revenge of Gaia, 2007) mit Sätzen wie „Die Sache ist gelaufen“ und „Es ist zu spät, wir müssen mit dem Unvermeidlichen zurechtkommen, wir sind am Ende“ zu Wort kommen läßt[5], scheinen solche minimal differenzierenden Kurz-vor-zwölf-Uhrenspielereien sowieso längst obsolet.

Hier gibt´s tatsächlich mal viel zu tun kurz vor 12, denn von „23.59“ muß fix umgebaut werden auf „00.00“: mitternächtliche Über-Stunde für die Bauarbeiter in Mark Formaneks Videoarbeit „Standard Time“(mit Dank für das Live-Photo aus der ZU an Anna Reimnitz).
Irritieren konnten pseudo-exakte Weltuntergangs-Uhrzeitangaben immer schon auch dann, wenn man mit Hans Blumenberg „Lebenszeit und Weltzeit“ nebeneinanderhielt und statt des angeblich drohenden Weltenendes das doch eigentlich viel konkretere eigene Lebensende ins Auge faßte. „Es ist fünf vor zwölf“ proklamiert wieder ein Mal ein fettgedruckter Artikeltitel einer Ausgabe der fiktiven Zeitschrift „ÖKO-SOS“ in Gabriele Wohmanns 1982 entstandener Kurzgeschichte „Fünf vor zwölf“[6]. Nur diesen Titel nimmt der Mann im Krankenhauszimmer seiner Ehefrau wahr; ihr gehört die Zeitschrift und sie hat eben durch eine gelungene Operation eine gefährliche Krankheit überstanden. Gerade darüber kann oder will sich ihr Mann aber nicht so recht freuen, er sinniert lieber (in Gedanken und unpassend-ungeschickterweise manchmal auch laut) über die manische Beschäftigung der Menschen mit dem „Gesundwerden, Gesundwerden, Gesundwerden“ und über „die alte Leier des Davongekommenseins“ (23). Er vermißt den ernsteren Gemütszustand der drohenden Lebensgefahr, die „frühere Würde des Ganzen, diesen Hauch von Abschied, etwas Schwebendes“ (22). Wohmann, der von Alice Schwarzer vorgeworfen worden ist, daß sie „männerfreundlich und nicht frauenfreundlich“ schreiben würde[7], läßt den Ehemann seine (zugegeben: komfortable) Unzufriedenheit mit dem allen anderen unterstellten würdelosen Willen zum Über- und Weiterleben auf seine Frau projizieren, die knapp dem Tod entronnen bereits im Genesungsbett wieder „den Eindruck von Selbstzufriedenheit und Rechthaberei“ (21) vermittelt und sich „zänkisch und mißmutig“ (23) zeigt. Der offenbar existentialistisch inspirierte Mann gönnt seiner Frau und all den zur Genesung gratulierenden Verwandten und Bekannten nicht die Erleichterung der überwundenen Ängste; für diese konstatiert er verwundert nur diesen einen Grund: „wir freuen uns nicht auf unseren Tod“ (25). Wo doch nur die Todesnähe für Lebens-Spannung, für Lebens-Ernst und -Würde sorgt; ohne sie zerfällt und verflacht das Leben, jener „Notbehelf“ (23), wie ein kaputter Luftballon: „Die Luft, der Tod, war raus“ (22). Das unerklärlich „Diffuse“ des entspannten Weiterlebens, das „ihn so unaufhaltsam störte“, deutet er sich so: „Es war nicht mehr fünf vor zwölf bei ihm“ (23).
Stattdessen, so muß der enttäuschte Ehemann feststellen, verkommt die 23.55-Uhr-Zeit-Bestimmungs-Floskel zur hohlen Pathosformel für den Umweltschutzaktivismus. Seine Frau würde sich mit ihrer ebenfalls überraschend überlebenden Krankenhaus-Bettnachbarin sofort wieder über ihre Zeitschrift „ÖKO-SOS“ austauschen: „sie wären sich über die Torschluß-Lage zum Beispiel der Nadelgehölze rasch einig, eben darin, daß es fünf vor zwölf war, wohin man blickte“ (25). Genau: Man will da überall etwas sehen, das „Man“ meint jene Seins- und Daseins-Vergessenen, die vor lauter Waldsterben den Ruf von Heideggers „Eigentlichkeit“ nicht hören und hinter der technischen Drei-Buchstaben-Abkürzung ihrer Gesinnungslektüre den tieferen, dringlicheren Sinn des eigentlich gemeinten „Save our Souls“ (25) nicht wahrnehmen. Als „zähmende, dringend notwendige Korrektur an der spannungslosen, schäbigen, heruntergekommenen, ebenerdigen Lebensart von Leuten […], die soeben eine Schwerstarbeit gegen den Tod hinter sich hatten“ muß dann der erste der Vier ernsten Gesänge von Johannes Brahms dienen, an den man, nein: der Mann unserer Geschichte sich erinnert, nachdem er einen „alten Chabrol-Film zum zweiten Mal gesehen hatte“ (25)[8]. Brahms hat in diesem ein Jahr vor seinem Tod geschriebenen Spätwerk für Gesang und Klavier die melancholisch-nihilistischen Verse aus dem alttestamentarischen Buch Kohelet vertont, die in der Luther-Übersetzung mit gut protestantischer Drastik verkünden: „Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh, wie dies stirbt, so stirbt er auch […] und der Mensch hat nichts mehr denn das Vieh, denn es ist alles eitel“ (Koh 3, 19-22). Der damit nur angedeutete biblische „Prediger“-Kontext gibt einen Hinweis, aus welcher Erkenntnis die entscheidende Alternative zur „Fünf-vor-Zwölf“-Rhetorik und die Überwindung der Todesangst und ihrer alltäglichen Verleugnung hervorgeht: jede metaphorisch aufgeladene Uhrzeiger-Symbolik wird schal und bedeutungslos, wenn schlicht „alles seine Zeit hat“. Was soll die Panikmache ablaufender Fristen, wenn sowieso gilt: „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit“ (Koh 3,1). „Ein jegliches“: also „alle“ und „alles“, tout le monde. Das heißt: es gibt gar keine Uhren und Zeiger, die überindividuell verbindliche Stunden anzeigen würden – jede/r/s hat seine/ihre Zeit.
Am Ende der 24. Stunde angelangt, kurz vor „old midnight“ (wie Ella Fitzgerald singt), dürfen wir endlich aus dem engen Korsett der streng gezählten Stunden und Minuten heraustreten. Ab sofort hat die Geburtsfeier jenes „saviours of our souls“ ihre Zeit, der seit je unsere Zeit wie unsere Zeitzählung und so auch die Idee dieses kollektiven Schreibprojekts bestimmt hat. Es ist nicht kurz vor zwölf, weil es noch nie kurz vor zwölf war: Es ist – endlich – Weihnachten.
Anmerkungen
[1] Daß dieser nicht für die ganze Welt verbindlich ist, zeigt einer global vernetzten Welt jeder Silvesterabend, wenn in Sydney schon die Sektkorken und die Böller knallen, während andernorts erst noch der Fonduekäse eingekauft werden muß.
[2] Der Text von Niels-Henning Ørsted Pedersen zum bekannten Jazz-Standard von Michel Petrucciani, wie ihn etwa Ella Fitzgerald (hier mit Oscar Peterson) gesungen hat.
[3] Vgl. Inge Konik, Revisiting The 11th Hour in Critical Ecological Times, in: Critical Arts, 32:2, 67-82, DOI: 10.1080/02560046.2018.1437198
[4] Vgl. dazu Juha A. Vuori, A Timely Prophet? The Doomsday Clock as a Visualization of Securitization Moves with a Global Referent Object, in: Security Dialogue, Vol. 41, No. 3 (June 2010, S. 255-277.
[5] Der Theatertext ist hier herunterladbar, vgl. auch Bruno Latour. Warten auf Gaia. Komposition der gemeinsamen Welt durch Kunst und Politik, in: M. Hagner (Hg.), Wissenschaft und Demokratie, Berlin 2012, 163-188 (pdf)
[6] Gabriele Wohmann, Fünf vor zwölf, hier zit. nach: dies., Bucklicht Männchen. Erzählungen, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1984, S. 19-26 (alle Seitenzahlen im Text beziehen sich auf diese Ausgabe).
[7] Vgl. dazu ihre eigene Aussage in: „Gabriele Wohmann reizt es, böse Bücher zu schreiben. Ein Interview über Selbstmord und niedere Instinkte, Gott und eine perverse Zirbeldrüse: So spannend ist das Leben nicht“, Interview mit Andreas Reeg, Berliner Zeitung, 18. Mai 2002.
[8] Wohmann meint sicher Que la bête meure (1969), in dem die Eingangs- und Ausgangszene mit jener Aufnahme des Stücks mit der Mezzosopranistin Kathleen Ferrier unterlegt sind, die auch in der Kurzgeschichte erwähnt wird. Der nur vordergründig reißerische Titel des Quasi-Thrillers (es geht um eine geplante Rache-Aktion) greift ebenfalls den Mensch-Tier-Vergleich des Kohelet-Texts aus dem Brahmslied auf.








































